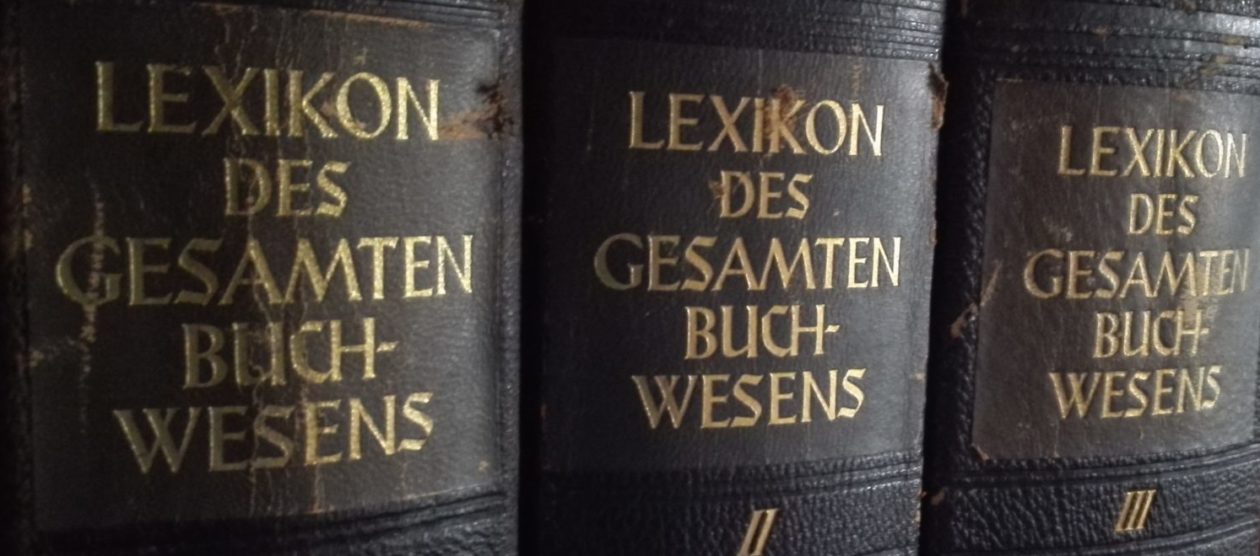Am 25. Oktober 2011 wird es im Rahmen des Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquiums (BBK) am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) an der Humboldt-Universität zu Berlin um das Thema „Theorie und Praxis der Bibliotheksmumie“ gehen. Die Lecture beginnt um 18:00 in Raum 208 (Achtung: Raumänderung!!) im IBI, Dorotheenstr. 26, 10117 Berlin.
Diskussion über Patron Driven Acquisition auf der Frankfurter Buchmesse
Am 14. Oktober gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema “PDA Patron Driven Acquisition – Fluch oder Segen für die Branche” im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Sofa 2011? von B.I.T.oline und Fachbuchjournal auf der Frankfurter Buchmesse.
Vortrag zu Open Access und Wissenschaftsfreiheit
Am 8. September 2011 habe ich in München zur Eröffnung von “Leibniz Publik”, dem Exzellenzportal für die Leibnizpreisträger der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einen Vortrag zum Thema “Modus oder Mode? Open Access und Wissenschaftsfreiheit” gehalten.
Aufsatz in GRUR-Prax. zu verwaisten Werken
In Heft 13 der GRUR-Prax. ist ein kleiner Beitrag zur geplanten EU-Richtlinie für die verwaisten Werke erschienen:
EU-Kommission will Digitalisierung verwaister Werke ermöglichen – Auswirkungen der geplanten Richtlinie auf Recht und Gesetzgebung in Deutschland, in: GRUR-Prax. 3 (2011), H. 13, S. 288-290.
Thesenpapier zu Urheberrecht und wissenschaftlichem Publizieren
Unter dem Titel „Publizieren in Zeitschriften – urheberrechtliche Aspekte“ ist ein kleines Thesenpapier anlässlich der Leviathan-Fachtagung „Sozial- und geisteswissenschaftliche Zeitschriften“ am 1. Juni 2011 am WZB in Berlin auf deposit::hagen erschienen.
Link
Vampyrologie in der FAZ besprochen!
Am 8. Juli hat Felix Johannes Enzian in der FAZ Nr. 156 auf S. 34 die „Vampyrologie für Bibliothekare“ freundlich besprochen und stellt fest: „Nach der Lektüre wirft man sich den Vampiren erst recht in die Arme.“
Aufsatz zur Geschichte der Theologenausbildung
In der Festschrift für Norbert Trippen ist ein Aufsatz zur Geschichte der Theologenausbildung in der katholischen Kirche erschienen:
Eine kurze Geschichte der Ausbildung katholischer Theologen in Deutschland, in: Heinz Finger, Reimund Haas, Hermann-Josef Scheidgen (Hrsg.), Ortskirche und Weltkirche : kölnische Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Zweitem Vatikanum : Festgabe für Norbert Trippen zum 75. Geburtstag. – Köln [u.a.] : Böhlau, 2011 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte ; 28), S. 899-913.
Handbuch zur Bibliotheksgesetzgebung erschienen
Bei Bock + Herchen ist ein zusammen mit Cornelia Vonhof herausgegebenes Handbuch zur Bibliotheksgesetzgebung erschienen. Es enthält neben einer grundlegenden Einführung in die Thematik und Analysen der Bibliotheksgesetze in Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt Materialien für ein baden-württembergisches Bibliotheksgesetz und einen Musterentwurf eines solchen Gesetzes.
Das Handbuch wurde von Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart erarbeitet. Es ist auch für Leser außerhalb Baden-Württembergs von Interesse, weil die auf Baden-Württemberg bezogenen Ausführungen auf andere Länder entsprechend angewendet werden können.
Steinhauer/Vonhof (Hrsg.), Bibliotheksgesetzgebung : ein Handbuch für die Praxis, insbesondere im Land Baden-Württemberg, Bad Honnef 2011, 304 S. ISBN 978-3-88347-278-2.
Das Handbuch wird am 8. Juni auf dem 100. Bibliothekartag in Berlin um 15 Uhr am Stand von Bock+Herchen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Vortrag beim Wissenschaftszentrum Berlin
Am 1 Juni 2011 habe ich einen Vortrag zum Thema “Publizieren in Zeitschriften – urheberrechtliche Aspekte” auf der Leviathan-Fachtagung “Sozial- und geisteswissenschaftliche Zeitschriften” am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gehalten.
Vortrag in Heidelberg
Am 31. Mai 2011 habe ich in Heidelberg einen Vortrag zum Thema “Das Archiv publiziert – (Verlags-)rechtliche Aspekte” auf dem 70. VdW-Lehrgang Archivrecht für Wirtschaftsarchivare: Sensibilisierung – Orientierung – Professionalisierung gehalten.